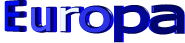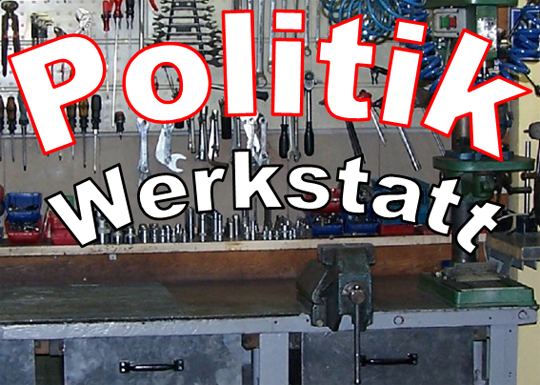Noch ist Cybermobbing ein unterschätztes Phänomen. Doch mittlerweile beginnen sich Schüler, Eltern und Lehrer zu wehren
Politiker und Experten fordern verstärkte Aufklärungsarbeit an Schulen
Als Tanja Schubert* das Video auf der Internetplattform YouTube entdeckte, war sie zunächst fassungslos. Auf dem per Handy aufgenommenen Filmchen schubsten und schlugen Schüler ihrer Schule einen Kameraden so lange, bis er nach acht Minuten weinend zusammenbrach. Eigentlich hatte sich die Schuldirektorin aus Sachsen auf das Thema Mobbing gut vorbereitet gefühlt. Seit sie vor ein paar Jahren eine Mittelschule in einer größeren Stadt übernahm, hatte sie zahlreiche Projekte gegen Mobbing eingeführt. Sie ließ Schüler zu Schlichtern ausbilden, führte einen Kurs über die Probleme des Erwachsenwerdens ein, stellte den Fünftklässern „Paten“ aus den höheren Klassen an die Seite. Für besonders auffällige Schüler organisierte sie einmal pro Jahr ein „Konfliktcamp“, wo diese mithilfe der Polizei und von Pädagogen lernen sollten, mit ihren Aggressionen umzugehen. Umso größer war der Schock, als sie ein Medienpädagoge auf das Video aufmerksam machte.
„Happy Slapping“ (etwa: Fröhliches Verdreschen) nennt es sich, wenn Schüler sich dabei filmen lassen, wie sie andere Schüler schlagen. Der Film wird anschließend per Handy verbreitet oder ins Internet gestellt. Happy Slapping ist einer der Spielarten des Cybermobbings, ein anderes das anonyme Verbreiten von Gehässigkeiten auf Internetplattformen wie „I share gossip“ (Ich teile Klatsch).
Das vor allem unter Schülern verbreitete Quälen Gleichaltriger mithilfe moderner Technologien ist ein noch unterschätztes Phänomen. „Cybermobbing führt zu realer Gewalt“, warnt Klaus Jansen, Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. „Jugendliche werden in den Medien zur Zielscheibe, das ist Realität an unseren Schulen. Wir müssen den Schülern genauer auf die Schnauze schauen und sie zu vernünftigen Regeln zurückführen.“ Die Forderung, der Staat solle sich aus dem Internet heraushalten, hält Jansen für falsch: „Betroffene Schüler fordern, dass ihnen geholfen wird. Sie wollen sich sicher fühlen, und das zu Recht.“
Eine britische Studie kam bereits 2006 zu dem Ergebnis, dass ein Viertel der Jugendlichen im Alter von elf bis 19 Jahren schon mindestens einmal Opfer geworden sind. Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest berichtet nun, dass ein Viertel der Zwölf- bis 19-Jährigen ein Mobbingopfer im Freundeskreis hat.
Die Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen wird Jahr für Jahr intensiver. Nach der Studie „Jugend, Information, Mutimedia“ loggen sich 70 Prozent der Jugendlichen täglich oder zumindest mehrmals die Woche in ein soziales Online-Netzwerk ein. 5,8 Millionen Schüler sind allein beim Netzwerk Schüler-VZ aktiv, haben über 200 Millionen Fotos hochgeladen. Knapp 40 Prozent der Jugendlichen geben an, dass darin Bilder ohne ihr Wissen online gestellt wurden. Etwa jeder Fünfte berichtet über fehlerhafte oder beleidigende Angaben.
Bislang sind es vor allem spektakuläre Fälle aus dem Ausland, die die Aufmerksamkeit auf das Thema Cybermobbing gezogen haben. Wie die Geschichte der 13-jährigen Megan aus einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Missouri. Megan war über beide Ohren in einen gewissen Josh verliebt, den sie über die Internet-Plattform MySpace kennenlernte. Der gut aussehende 16-Jährige interessierte sich für das übergewichtige Mädchen, das als freundlich, aber depressionsgefährdet galt. Was Megan nicht wusste: Hinter Josh verbarg sich in Wirklichkeit kein Junge, sondern die ehemals beste Freundin aus der Nachbarschaft. Als Megan mit ihr brach, wollte sie Rache. Mithilfe ihrer Mutter baute sie die Figur von Josh auf. Einen Angestellten der Mutter zog sie zurate, um den männlichen Charme überzeugend rüberzubringen.
„Masquerade“ nennen Sozialwissenschaftler diese Methode, bei der sich eine Person eine falsche Identität zulegt, um eine andere zu quälen. Der Anfang von Megans Ende war eine kleine Nachricht von Josh: Er wolle mit ihr keinen Kontakt mehr, weil er gehört habe, dass sie schlecht mit ihren Freunden umgehe, eine böse Person sei. Fortan hatte Josh nur noch Demütigungen für Megan übrig. Andere MySpace-Mitglieder begannen, Megan als fette Schlampe zu beschimpfen. Sie erhängte sich im Keller ihres Elternhauses.
Über die Landesgrenzen bekannt wurde auch das Schicksal des Kanadiers Ghyslain Raza. 2002 hatte der pummelige 15-Jährige in der schuleigenen Videowerkstatt ziemlich unbeholfen mit einem Golfschläger Szenen aus dem Film „Star Wars“ nachgestellt. Das Video gelangte in die Hände von drei Klassenkameraden, die es ins Internet stellten. In wenigen Wochen wurde es unter dem Titel „Star Wars Kid“ zu einem der meistgesehenen Videos seiner Zeit. Raza musste in psychiatrische Behandlung. Seine Eltern verklagten die Familien der Schüler wegen des Vorfalls; in einem außergerichtlichen Vergleich bekam Raza umgerechnet rund 150 000 Euro Schmerzensgeld. Inzwischen studiert er Jura in Montreal. Das Video verfolgt ihn bis heute.
Aber schon harmlosere Formen des Cybermobbings können für Jugendliche traumatisch sein. Die zwölfjährige Berliner Schülerin Felicitas Bellmann* ist ein hübsches, aufgewecktes Mädchen mit einem großen Freundeskreis. Doch vor einem halben Jahr wollte sie plötzlich nicht mehr zur Schule gehen. Ein Mitschüler, mit dem sie einmal befreundet war, hatte nach der Trennung mit seiner neuen Freundin eine „Anti-Feli-Gruppe“ auf der Plattform Schüler-VZ gegründet. Die öffentliche Demütigung zog schnell Kreise. Mitschülerinnen begannen, Partyfotos von Felicitas auf Facebook hämisch zu kommentieren. Als Felicitas‘ Mutter von den Vorfällen erfuhr, machte sie von allen Demütigungen im Netz PDF-Dateien und wandte sich an die Schulleitung. „Die hatten keine Ahnung, was die Schüler im Internet so treiben“, sagte Bellmann.
Immerhin reagierte die Schulleitung sofort, sprach mit dem Jungen, der das Mobbing ausgelöst hatte – die „Hass“-Gruppe wurde entfernt, der Junge musste sich entschuldigen. Susanne Bellmann schaut ihrer Tochter inzwischen regelmäßig über die Schulter, wenn diese im Internet unterwegs ist. Und ist entsetzt, wie nachlässig dort viele Kinder mit ihren privaten Informationen umgehen.
„Viele Schüler haben keine Hemmschwelle und geben alles von sich preis: Fotos im Bikini oder oben ohne; sie schreiben ihre Adresse in ihr Profil“, sagt Inga Bürger, Referendarin am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Köln. Bürger hat über Cybermobbing ihre Examensarbeit geschrieben. Laut einer empirischen Untersuchung aus Saarbrücken sind 74 Prozent der Cybermobbing-Täter auch im realen Leben diejenigen, die andere Menschen mobben.
Bürger beobachtet aber auch, dass bisweilen diejenigen im Internet über andere herziehen, die im realen Leben selbst Opfer von Ausgrenzung sind und nun zurückschlagen. Um sich zu schützen, rät Bürger den Schülern bei der Erstellung ihres Online-Profils einen Spitznamen zu benutzen und sich an die Richtlinie zu halten, zu der auch die EU rät: Im Internet nur das von sich preiszugeben, was man auch bereit wäre einem Fremden auf der Straße zu erzählen. Das ist meist nicht mehr als der Vorname.
Schutz ist wichtig, denn rechtlich gibt es beim Cybermobbing noch eine Lücke. „Es gibt viele Gesetze, die gegen Cybermobbing anwendbar sind, etwa das Recht am eigenen Bild oder den Straftatbestand der Beleidigung“, sagt Günter Krings, Vize-Fraktionschef der CDU, Rechtsanwalt und Medienexperte. „Wir brauchen allerdings einen EU-weit einheitlichen Rechtsstandard des Kinder- und Jugendschutzes, sodass wir auch Angebote aus dem Netz nehmen können, wenn der Server im Ausland steht.“ Noch dringender sei die Entfaltung einer neuen Streitkultur an Schulen. „Die Schüler brauchen Unterstützung, damit sie die Dinge nicht in sich hineinfressen, Lehrer müssen geschult werden, sodass jedem klar ist, wer mobbt, ist nicht cool, sondern vielmehr ein armes Würstchen.“
In Frankfurt und Berlin sei Cybermobbing derzeit besonders ausgeprägt. Jetzt müssten Maßnahmen getroffen werden, um die Ausdehnung auf die ganze Republik zu verhindern. „Die Schulen müssen verpflichtet werden darzulegen, was sie gegen Mobbing tun.“
Die soziale Ausbildung der Schüler fehlt derzeit im Schulkonzept. Die Schulen finden sich beim Thema Cybermobbing in einer heiklen Situation wieder. Einerseits haben sie eine Fürsorgepflicht, andererseits müssen sie die Privatsphäre der Schüler respektieren. Die Unfallkasse Bremen hat nun einen Ratgeber für Lehrer zum Umgang mit Cybermobbing veröffentlicht. Auf 54 Seiten werden das Phänomen und die Risikofaktoren sowie die rechtliche Lage erläutert. Gleichzeitig gibt die Broschüre Tipps, wie man mit Mobbing an der Schule umgeht. Das Erstellen von Klassenregeln gegen Mobbing, sofortiges Eingreifen bei Vorfällen, vertrauliche Gespräche mit dem Opfer und das Einbinden der Eltern gehören dazu.
Auch im Fall des Happy-Slapping-Videos an der sächsischen Mittelschule zeigte sich, wie wichtig die schnelle Reaktion ist – und wie hilfreich ein bereits existierendes Netzwerk gegen Mobbing sein kann. Als Erstes veranlasste Schulrektorin Schubert, dass der Film umgehend aus dem Internet verschwand. So weit das möglich ist. Dann bestellte sie Opfer und Täter samt Eltern ein. Die Mutter des Täters konnte sie davon überzeugen, den schon zuvor auffällig gewordenen Jungen in eine Therapie zu schicken. „Ich kenne alle meine Schüler, bei uns kann sich niemand in der anonymen Masse verstecken“, sagt Schubert. Sie hat das Video zudem zum Anlass genommen, um ein Handyverbot an der Schule durchzusetzen. „Die Schule muss klare Linien haben“, sagt Schubert. „Und den Schülern muss klar sein, was passiert, wenn sie dagegen verstoßen.“ Vor ein paar Wochen hat sie eine Schülerin, die gegen das Handyverbot verstieß, für einige Tage von der Schule suspendiert.
Quelle: http://www.welt.de/print/wams/politik/article13127732/Kampf-gegen-die-digitale-Quaelerei.html