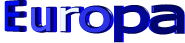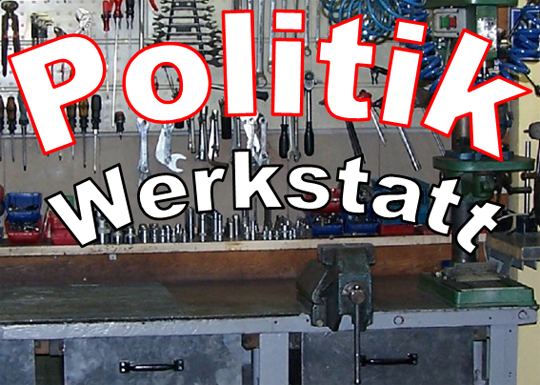Von Stefan Hohler.
Mobbing mithilfe der Neuen Medien hat unter Schülern sprunghaft zugenommen. Dass heute fast alle Jugendlichen in der Schweiz einen Internetzugang und ein Handy haben, erleichtert die Übergriffe.
Ins Internet kommt man heute fast überall: Drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen haben auch im eigenen Zimmer Internetzugang.
Wenn auf Facebook plötzlich Drohungen auftauchen
Der 13-jährige Martin (Name geändert) will unbedingt Profifussballer werden. In seinem Team fühlt er sich schlecht integriert und wechselt zu einem Spitzenclub in der Stadt. Voller Freude schreibt er dies in sein Facebook-Profil. Ein Mitspieler aus seinem ehemaligen Club und dessen Bruder sehen die Nachricht, und sie beginnen, ihn übers Internet zu provozieren. Martin erhält wiederum online Unterstützung von einem Kollegen aus dem neuen Club. Erst geht es nur um Sticheleien, doch bald wird mit härteren Bandagen gekämpft. Der Verbalkampf gipfelt nach einer Woche in Martins Drohung, er werde mit seinem gesamten Fussballteam vorbeikommen und die beiden vermöbeln. Martins neuer Trainer kriegt zufällig die verbalen Attacken auf dem Facebook-Profil seines Schützlings mit und greift ein. Er sagt: «Dank dem frühen Intervenieren konnte eine Eskalation verhindert werden.» Martin sagt, er habe die Drohung nicht ernst gemeint, er habe lediglich Angst gehabt, dass seine ehemaligen Mannschaftskollegen ihn am nächsten Tag in der Schule angreifen würden. Sein Trainer hat ihn aufgefordert, die Konversation von seinem Profil zu entfernen, seither ist wieder Ruhe. (rsa)
Cyberstalking
Wenn ein Täter Telefonnummern in Sex-Chats verbreitet
Selina (Name geändert) ist eine attraktive junge Frau mit vielen Verehrern. Doch als sie gleich mehrere von ihnen abweist, lässt einer sie nicht mehr in Ruhe. Plötzlich erhält sie von ihm endlose und äusserst aufdringliche E-Mails. «Aus unerfindlichen Gründen wusste der Schreiber alles über mich, inklusive meiner Telefonnummer und meiner E-Mail-Adressen», erzählt Selina. Schliesslich verbreitet er ihre Telefonnummer in Sex-Chats: «Das war extrem unangenehm.» Weil Selina nicht weiss, welcher Ex-Verehrer sie belästigt, übt sie Druck auf den Betreiber des Sex-Chats aus und gelangt so an die IP-Adresse des Täters. Mit dieser lässt sich der Absender der Mails eruieren. «Dann drohte ich ihm mit einer Anzeige.» Dies habe glücklicherweise gereicht; die Belästigungen hätten aufgehört. Heute schaue sie peinlich genau darauf, dass man im Internet keine Angaben zu ihrer Person finde, sagt Selina. «Nur die Schule, in der ich arbeite, stellt sich quer.» Diese bestehe darauf, dass ihre Stundenpläne und ihre Adresse im Internet einsehbar seien. «Das muss sich noch ändern, ich will so etwas nicht mehr erleben müssen.» (rsa)
Rund fünfzigmal mussten im vergangenen Jahr Fachleute einschreiten, weil an Zürcher Schulen Jugendliche von Mitschülern mit Computer und Handys gemobbt wurden. Im Fachjargon heisst das Fertigmachen und Ausgrenzen mithilfe Neuer Medien Cybermobbing oder Cyberbullying (was so viel bedeutet wie Cybertyrannei). Die «Kreativität» der Jugendlichen scheint dabei keine Grenzen zu kennen: Schüler beleidigen und drohen Mitschülern an der Facebook-Pinnwand oder machen verfängliche Handyaufnahmen im Schulhaus. Auch die Lehrer sind immer wieder Ziel von Mobbingattacken. Die Schüler kreieren Anti-Lehrer-Websites und entsprechende Facebook-Profile. Oder sie bestellen für einen Lehrer Waren über das Internet.
Die rund fünfzig Cybermobbing-Fälle machen etwa ein Drittel der Fälle aus, bei denen Roland Zurkirchen und seine Leute in eine Klasse gerufen werden. Zurkirchen ist Troubleshooter beim Zürcher Schul- und Sportdepartement. Er leitet das achtköpfige Team der Fachstelle für Gewaltprävention. Auch die Polizei weiss um die Probleme, Risiken und Gefahren des virtuellen Raums: Bei der Kantons- und der Stadtpolizei Zürich gingen im Jahr 2008 insgesamt 33 Anzeigen ein, bei denen das Internet die «Tatwaffe» war. Es handelte sich um Fälle, bei denen Jugendliche und Erwachsene mittels E-Mails oder in Chatrooms belästigt, genötigt oder bedroht worden waren. In der Regel geht es um Delikte unter dem Titel Ehrverletzung oder Stalking (bei Letzterem stellt eine Person, oft ein enttäuschter Verehrer oder ein verletzter Ex-Partner, einer anderen Person systematisch nach). Im Jahr 2009 lag die Zahl der Anzeigen bereits bei 41. Allerdings geht die Polizei von einer grossen Dunkelziffer aus, da viele Opfer aus Scham oder aus Angst vor Repressalien auf eine Anzeige verzichten.
Fehlendes Bewusstsein
«Datenschutz, ja und?» Diese Antwort bekommt Zurkirchen immer wieder zu hören, wenn er mit Jugendlichen zu tun hat. Die Schüler würden erst ab einem gewissen Alter, meist im späten Teenager-Alter, die ins Internet gestellten Informationen hinterfragen. Begriffe wie Persönlichkeitsschutz seien für Jugendliche inhaltsleere Technokraten-Vokabeln. Obwohl die meisten Jugendlichen zur klassischen Netz- und Cybergeneration gehören, also mit Handys, Internet und Chatrooms aufgewachsen sind, sind sich viele Kinder und Jugendliche nicht bewusst, was sie damit alles anrichten können. Zum Beispiel, was es konkret bedeutet, wenn sich eine Nachricht im virtuellen Raum innert kürzester Zeit explosionsartig verbreitet.
Was dies konkret bedeutet, wird hingegen dem gemobbten Schüler sehr bewusst. Nach der Erfahrung von Gewaltexperte Zurkirchen haben die meisten Schüler auf Facebook einen «Freundeskreis» von 400 bis 500 Personen. Klickt jetzt einer dieser «Freunde» nach dem Lesen des Mobbingtexts auf «gefällt mir», erhalten alle seine weiteren «Freundinnen» und «Freunde» diese Nachricht ebenfalls. Ein Unterbinden des Informationsflusses ist nicht mehr möglich. Damit Jugendliche den Umgang mit den Neuen Medien lernen würden, sei das Engagement der Eltern zentral, betont Roland Zurkirchen. Denn diese hätten noch immer den grössten Einfluss auf ihre Kinder, gefolgt von Jugendlichen in vergleichbarem Alter, den Medien und – erst an vierter Stelle – der Schule.Wie wichtig das Engagement für die Cyberaufklärung ist, zeigen die Zahlen. Schweizer Jugendliche haben nahezu unbeschränkte Möglichkeiten und Gelegenheiten, einen Mitschüler per Mausklick fertigzumachen. Die jüngste James-Studie (Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz 2010) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat ergeben, dass 99 Prozent der 12- bis 19-Jährigen einen Computer zu Hause haben. Drei Viertel von ihnen haben gar einen eigenen Computer mit Internetzugang in ihrem Zimmer. 98 Prozent der 12- bis 19-Jährigen besitzen ein Handy. Diese aktuellen Zahlen sind vor kurzem am vierten Zürcher Präventionsforum veröffentlicht worden. Fachleute plädieren dafür, dass der Zugang zum Internet bei Kindern erschwert wird. Zum Beispiel, indem man den Computer nicht im Kinderzimmer, sondern im Wohnzimmer installiert. Oder indem das Internet nicht permanent zur Verfügung steht. In den Stadtzürcher Schulhäusern besteht seit 1999 ein Handybenutzungsverbot.
Keine Wiedergutmachung
Mobbing beginnt oft in der realen Welt und wird anschliessend im Internet weitergeführt. Der Unterschied: Beleidigende und verletzende Sprüche, Bilder oder Texte bleiben im Netz. Eine Wiedergutmachung nach Cybermobbing ist somit bedeutend schwieriger als bei einem realen Mobbing.
Experte Zurkirchen erwähnt ein Beispiel aus einer Zürcher Schule. In einer fünften Primarklasse hatten Schüler einen Klassenkameraden auf dem WC mit dem Handy gefilmt – trotz Handybenützungsverbot. Zuerst wurde der Film auf dem Pausenplatz gezeigt, dann auf Facebook veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wurde Zurkirchens Team von der Schule aufgeboten. Man stellte fest, dass das Opfer innerhalb des Klassenverbands bereits völlig ins Abseits gedrängt worden war: «Es hat so massiv gelitten, dass wir nur noch eine Verlegung in eine andere Klasse empfehlen konnten.» Dies taten Zurkirchen und sein Team nur ungern, da die Mitschüler das Ziel – die totale Ausgrenzung des Klassenkameraden – damit erreicht hatten. Aber es gebe Situationen, in denen man nicht anders handeln könne. Bei diesem extremen Fall von Cybermobbing wurde auch ein Stadtpolizist des Jugenddienstes beigezogen. «In Uniform, damit die Rollenzuteilung klar wurde – und auch, damit es den Schülern richtig einfährt», wie Zurkirchen betont. Die Fachstelle versuchte in der Aufarbeitung des Falles eine «Empathieumkehrung» zu bewirken. Das heisst, die Schüler sollten sich in die Rolle des Opfers einfühlen. Wieweit man dies erreicht habe, sei ungewiss, sagt Zurkirchen. Immerhin habe man von der Klasse bisher keine weiteren negativen Feedbacks erhalten.
Vulgäre Sprüche
Auch wenn die Experten dem elterlichen Aufklärungseinsatz in Cyberangelegenheiten viel Gewicht beimessen, ist ihnen bewusst: Solche Einsätze sind anspruchsvoll. Zum Beispiel, weil Jugendliche, wenn sie im Internet kommunizieren und chatten, einen ganz anderen Wortschatz gebrauchen als Erwachsene. Entsprechend schockiert sind diese, wenn sie die einschlägigen Einträge lesen. «Die Erwachsenen werten die Aussagen und Ausdrücke mit ihrem Wertesystem, das vielfach nicht dem der Jugendlichen entspricht», sagt Roland Zurkirchen. Das heisse nicht, dass man die vulgären, primitiven und teils obszönen Sprüche akzeptieren müsse, aber für die Jugendlichen hätten sie nicht die gleiche Bedeutung wie für die Erwachsenen.
Obwohl Cybermobbing schwierig zu bekämpfen ist: Hilflos sind die Fachleute nicht. Zurkirchen betont, dass eine Intervention immer in der realen Welt geschehen müsse. Die Reaktion auf die Mobbingaktion dürfe also nicht via Computer oder Handy erfolgen. Wichtig sei auch, dass man nicht einfach «draufloswurstle». Wenn Zurkirchen und sein Team in eine Schule gerufen werden, folgen sie konsequent einem vierteiligen Ablauf: Analyse – Ziel – Methode – Evaluation (Beurteilung). Der Experte weiss: «Jede Situation ist anders, auf jeden Fall muss speziell eingegangen werden.» Deshalb sei eine präzise Analyse von grosser Bedeutung. Stets in die Überlegungen einbezogen werde auch die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten. Sie mache vor allem bei anonymen Attacken Sinn. Und, ergänzt der Experte, um allen Involvierten klarzumachen: «Der Cyberraum ist kein straffreier Raum.»